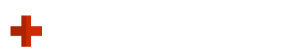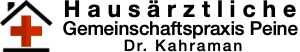Verordnen die Ärzte in Deutschland zu wenige oder zu viele Opiate? In den Medien wird dieses Thema derzeit wieder kontrovers diskutiert. Professor Klaus-Dieter Kossow beleuchtet in seinem Kommentar die Sachlage.
In der Nachkriegszeit von 1945–1955 war der Missbrauch von Betäubungsmitteln durch ehemalige Ärzte und Sanitäter der Wehrmacht sehr häufig. In den Feldlazaretten waren Opiate leicht erreichbar und auch die Arbeitsbedingungen förderten die Entwicklung einer Abhängigkeit, die dann auch nach Ende des Krieges noch bestand.
Ärzte unter Beschuss
Abhängige Ärzte wurden in der Berufsüberwachung durch die Ärztekammer ein Problem und auch in den nichtärztlichen Medien ein Thema. Die Betäubungsmittelverordnung wurde bürokratisiert. Bald änderte sich in den sechziger Jahren die Richtung der Kritik auch in den Publikumsmedien. Gefährliche Nebenwirkungen von Schmerzmitteln ohne Opiate, wie zum Beispiel Novaminsulfon und manche Rheumamittel, kamen ins Gerede und gerieten in den Medien unter Beschuss. Fortan hieß es: „Die Ärzte in Deutschland verordnen besonders bei Tumorpatienten zu wenig Betäubungsmittel.“
Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 22. Januar 2014 (Artikel von Martina Lenzen-Schulte auf Seite N1) können wir nun unter der Überschrift „Vom Arzt zum Dealer“ entnehmen, dass ganz offensichtlich die Medien sich in ihrer Kritik des ärztlichen Verordnungsverhaltens anschicken, abermals die Richtung zu wechseln.
Ursache dafür ist eine Reihe von Publikationen in medizinischen Fachjournalen Europas und der USA. So zum Beispiel im „European Journal of Anaesthesiology“ (Bd. 30, Seite 50). Dort warnen Arnaud Stayaert et al. vor einer zu lang dauernden Opiatmedikation nach Operationen, die sich eingebürgert hat, weil ein wirksames postoperatives Schmerzmanagement die Erholungszeit nach der Operation verkürzt. Oft können Patienten auf Knopfdruck selbst die Opiatdosis bestimmen, die zur Schmerzfreiheit erforderlich ist. Die Autoren machen darauf aufmerksam, „dass 10 % der Operierten, die sieben Tage nach dem Eingriff noch Opioide erhielten, diese ein Jahr später immer noch benötigen.“ Im Rahmen des postoperativen Schmerzmanagements solle man daher die Opiatdosis so gering wie möglich halten.
Machen Hausärzte etwas falsch?
Christoph Maier, Chefarzt der Abteilung für Schmerzmedizin am Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum, nennt seine Kollegen „legale Dealer“. Hausärzte machten in der Schmerztherapie ebenso viel falsch wie Orthopäden oder Schmerztherapeuten selbst. Der Anstieg von Opioid-Verschreibungen hierzulande sei indiskutabel. Es sei nur deshalb bisher in Deutschland nicht zu einer Erhöhung der Todesfälle wie in den USA gekommen, weil die Arzneimittel, die hier üblicherweise eingesetzt werden, nicht so schnell freigesetzt werden wie die in den USA gebräuchlichen.
Zusammenfassung der Expertenempfehlung: Opiatverordnung bei Tumorschmerzen ist geboten, postoperative Behandlung mit Opiaten sollte mit möglichst niedriger Dosis erfolgen, bei Rückenschmerzen und anderen Indikationen, wie zum Beispiel Gelenkbeschwerden, Migräne oder Spasmen, sollten Opiate möglichst vermieden werden und stattdessen Ibuprofen, Triptane oder Spasmolytika, Physiotherapie und Psychotherapie angewendet werden.
Aber Vorsicht: Expertenrat aus der Klinik für die Praxis muss hausärztlich abgesichert werden. Ich empfehle dazu die Leitlinien der DEGAM, beispielsweise zu Nackenschmerzen, Rückenschmerzen und Brustschmerzen.
Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2014; 36 (4) Seite 84